Text: Tom Waurig — Fotos: Luca Abbiento
2017 wurde das Ausmaß des Online-Hasses auch in Deutschland sichtbar. Studien und Berichte zeigten, wie sich neurechte und rechtsextreme Gruppierungen zu Netzwerken zusammenschließen, um mit Hassrede Meinungen und Debatten zu manipulieren.
Wissenschaftlerin Julia Ebner vom Londoner Institute for Strategic Dialogue unterwanderte sechs Monate lang Deutschlands größte Trollfabrik. Das gleiche gelang den Journalisten Rayk Anders und Patrick Stegemann, die sich undercover in Netzwerke einschleusten, von Shitstorms, Mobbingattacken und Wahlmanipulationen berichteten.
„Wir befinden uns im Krieg, im Informationskrieg“, hieß es bei Reconquista Germanica – einer der bekanntesten Gruppen, einer selbsternannte elektronische Armee, die sich nach amerikanischem Vorbild vor der Bundestagswahl zusammenfand, um diese zu Gunsten der AfD zu beeinflussen.
Die Strukturen der rechtsextremen Troll-Truppen sind streng hierarchisch, der Ton ist militärisch. In geschlossenen Foren vereinbaren sie genaue Uhrzeiten, Hashtags wie #TrauDichDeutschland und Zielscheiben ihrer Hasskampagnen, um die Algorithmen der sozialen Netzwerke zu manipulieren und den politischen Online-Diskurs zu diktieren – und das mit Erfolg. Studien zeigen, dass nur fünf Prozent aller Social-Media-Accounts für 50 Prozent der Likes bei Hasskommentaren verantwortlich sind.

Veröffentlichungen waren sehr beunruhigend, denn sie beweisen, dass die Einschüchterung im Netz funktioniert. Der Hass trifft nicht nur Einzelne, er hat auch immer eine demokratiegefährdende Dimension“, sagt Anna-Lena von Hodenberg, Leiterin der Beratungsstelle HateAid, die Ende letzten Jahres ihre Arbeit aufnahm und seitdem 74 Menschen unterstützt hat.
Hilfe für Opfer von digitaler Gewalt
HateAid entstand auf Initiative von Campact und Fearless Democracy – einem Zusammenschluss von Medienschaffenden und Kommunikationsfachleuten, die zu verstehen versuchen, wie digitale Medien zum Instrument von Populismus und Extremismus werden. Unweit des Berliner Ku’damm haben Anna-Lena von Hodenberg und ihre Mitarbeitenden ein Büro bezogen. Die HateAid-Chefin hat es schlicht, geradezu bescheiden eingerichtet. Am Rand eines großen weißwandigen Raumes steht ein kleiner Schreibtisch – gegenüber eine Anrichte mit Familienfotos.


Meterhohe Decken mit Stuck lassen den Arbeitsplatz fast schon verloren wirken. Für von Hodenberg bietet die Leere viel Raum zum nachdenken, wie sie erklärt, etwa über die Situation im Netz: „Diese Trolle versuchen“, sagt die 37-Jährige, „andere mundtot zu machen, zum Schweigen zu bringen und zu drängen.“
Bevor sie die Betroffenenberatungsstelle HateAid mitgründete, arbeitete sie als Campaignerin für die Online-Beteiligungsplattform Campact. Dort war sie für Antirassismus zuständig und für eine Kampagne in Hessen, die sich mit Hate Speech beschäftigt hat. So stand sie vor und nach den Landtagswahlen Ende letzten Jahres in engem Kontakt mit Anwaltschaften, Beratungsstellen, der Polizei und Betroffenen.
„In vielen Fällen war es sogar für mich als Laie offensichtlich, dass es sich bei Memes oder Kommentaren um strafrechtlich relevante Inhalte handelt. Deshalb habe ich mich immer gefragt, warum das nicht zur Anzeige gebracht wird.“ In den unzähligen Gesprächen, die von Hodenberg in Hessen geführt hatte, wurde ihr der Grund dafür klar: Für viele Betroffene ist es nahezu unmöglich, einen Vorfall zur Anzeige geschweige denn vor Gericht zu bringen.
Strafanzeigen, die ins Leere laufen
„Wer Opfer von digitaler Gewalt geworden ist, hat kein blaues Auge und auch kein gebrochenes Bein – und die Betroffenen können auch nicht nachweisen, dass sie etwa an Schlafstörungen leiden. In solchen Fällen zählt das Wort des Opfers“, erklärt von Hodenberg. Mit HateAid sollte deshalb die erste Beratungsstelle in Deutschland geschaffen werden, die sich solcher Taten annimmt und die versucht, geltendes Recht durchzusetzen.
Erschwerend hinzu komme, dass es vor HateAid nicht nur an Hilfsangeboten fehlte, sondern dass Polizei oder Justiz wenig bis gar nicht für das Thema sensibilisiert seien. Betroffene würden oft abgewiesen oder Anzeigen meistens nur stiefmütterlich behandelt. „Wenn Sie eine überlastete Staatsanwaltschaft haben, die zwischen einer Beleidigung im Netz und einem Raubüberfall entscheiden muss, dann fällt das erste meistens hinten runter.“
„Für mich ist es jedoch keine Bagatelle, wenn sich Menschen zusammenschließen, um andere im Netz fertigzumachen“, so von Hodenberg. Betroffen seien vor allem Frauen, muslimisch Gläubige, Menschen mit Migrationshintergrund, Medienschaffende oder Abgeordnete.
Angetreten ist das Team von HateAid, um sich schützend an deren Seite zu stellen und ihnen dabei zu helfen, Delikte zur Anzeige zu bringen und zivilrechtlich dagegen vorzugehen. „Wenn sich der Eindruck verfestigt, dass sich Betroffene nicht wehren können, ziehen sie sich zurück und die Trolle fühlen sie dadurch bestärkt. So werden immer wieder neue Grenzen des Sagbaren eingerissen, um zu schauen, wie weit kann ich eigentlich noch gehen, ohne dass es Konsequenzen gibt.“ Viele Betroffene glauben außerdem, dass sie sich Anfeindungen gefallen lassen müssten, weil der Ton im Netz rauer sei.
Wenn Prozesse am Geld scheitern
Geholfen wird allen, die sich an HateAid wenden, egal, ob die Inhalte, mit denen sie konfrontiert wurden, strafrechtlich relevant sind oder nicht. Nur eine psychologische Betreuung für Betroffene bietet der Verein nicht an. Das Team kooperiert aber mit anderen Stellen – Angebote gebe es dazu genügend, weiß von Hodenberg, und doppelte Strukturen wolle sie unbedingt vermeiden. Kontakt aufnehmen können die Betroffenen per Telefon, E-Mail, aber genauso über Facebook oder Twitter.
Darüber hinaus sind die Mitarbeitenden selbst im Netz unterwegs, um Profile aufzuspüren, die im Netz angegriffen werden – in solchen Fällen bieten sie entsprechend Hilfe an. „Wer in einem Hate Storm steckt, ist erst einmal verwirrt und auch emotional überfordert. Dann ist es meistens zu viel verlangt, sich auch noch eine Beratungsstelle zu suchen“, sagt Anna-Lena von Hodenberg.

Doch um gegen den Hass vorzugehen, braucht es auch das nötige Kleingeld. Wer nämlich Delikte zur Anzeige bringen will, kommt nicht ohne juristischen Beistand aus. 2000 Euro müssten Betroffene ungefähr aufbringen, das zeigen Recherchen von HateAid. Wer seinen Prozess verliert, zahlt der Gegenseite nochmal dieselbe Summe. Geld, das die wenigsten bereit seien zu riskieren, weiß von Hodenberg. Um juristische Verfahren zu ermöglichen, geht HateAid für die Betroffenen von digitaler Gewalt in Vorkasse, um deren juristischen Beistand entsprechend zu vergüten, wenn diese eine Chance auf Erfolg sieht.
Führt eine Anzeige zur Verurteilung, fließt der Schadensersatz zurück an den Verein, um damit weitere Klagen und Prozesse finanzieren zu können. Scheitert das Vorgehen wider Erwarten doch vor Gericht, trägt HateAid trotzdem alle angefallenen Kosten.
Netzwerke kämpfen mit Hassrede
Von Hodenberg erklärt ihr Modell wie folgt: „Wenn du juristisch gegen den Hass im Netz vorgehst, machst du in erster Linie etwas für dich selbst – aber genauso für andere und für die Gesellschaft, weil du dich zur Wehr setzt, für Abschreckung sorgst oder andere dazu motivierst, es dir gleich zu tun.“
HateAid versucht die Betroffenen, die das Team betreut, so gut wie möglich zu entlasten und nur mit dem allernötigsten zu kontaktieren. „Digitale Gewalt löst viel Stress aus. Betroffene wollen sich also auch nicht ewig damit auseinandersetzen. Sie möchten, dass es aufhört und sie wollen wieder ihr Leben leben und das Erlebte verdrängen.“ Nichtsdestotrotz hat von Hodenberg ein Interesse daran, die Vorfälle strafrechtlich zu verfolgen. Und die Erfahrung zeige: Wer sich gegen den Hass im Netz zur Wehr setze, der schrecke auch in Zukunft nicht vor Online-Debatten zurück.

Von Hate Speech spricht von Hodenberg nur selten, sieht den viel bemühten Begriff auch nicht als passende Erklärung der eigenen Arbeit – besonders deshalb nicht, weil damit kein Straftatbestand benannt werde. Ohnehin fehle es an einer eindeutigen Definition. Der Europarat versuchte sich vor Jahren bereits an einer.
Nach dessen Beurteilung meint Hate Speech „jegliche Ausdrucksformen, welche Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder andere Formen von Hass, die auf Intoleranz gründen, propagieren, dazu anstiften, sie fördern oder rechtfertigen“.
Weitaus treffender findet Anna-Lena von Hodenberg den Begriff der digitalen Gewalt. Darunter fasst sie zum Beispiel Beleidigungen, Verleumdungen oder Bedrohungen – allesamt Delikte, für die das Strafgesetzbuch klare Definitionen kennt. Das sei im Einzelfall zu prüfen und entsprechend zu bewerten.
„Es gibt genauso Aussagen, die wir wahrscheinlich eklig oder unerträglich finden, die wir trotzdem aushalten müssen, weil sie von der Meinungsfreiheit geschützt sind. In solchen Fällen sind wir alle gefordert, andere Lösungen zu finden, um damit umzugehen.“ HateAid bietet Betroffenen deshalb auch eine Kommunikations- oder Sicherheitsberatung an. „Wir helfen ihnen nicht nur beim Stellen der Strafanzeige, sondern genauso bei Löschanträgen im Netz oder rechtssicheren Screenshots“, sagt von Hodenberg. Viele Betroffene hätten auch große Angst davor, dass ihre Social Media- und E-Mail-Konten gehackt würden, andere suchen nach Tipps, wie sie auf Anfeindungen oder Lügen reagieren können. Aber macht das tatsächlich Sinn?
Solidarität der Online-Community
Einen allgemeingültigen Rat zum kommunikativen Umgang mit Hate Storms kann von Hodenberg nicht geben. Das habe viel mit der individuellen Situation zu tun. Während Privatpersonen eine mehrwöchige Social-Media-Auszeit nehmen könnten – damit sich der Mob beruhigt –, sei das bei Personen des öffentlichen Lebens nicht ganz so einfach.
Medienschaffende zum Beispiel würden mit dem Netz ihr Geld verdienen und könnten sich daher auch nicht ohne weiteres zurückziehen. Die HateAid-Gründerin rät dazu, Fälle digitaler Gewalt mit der eigenen Community zu teilen und auch den eigenen Umgang damit transparent zu machen. So hätten andere die Möglichkeit, sich in die Diskussion einzumischen. Außerdem könnten Betroffene überlegen, meint von Hodenberg, ob sie versuchen wollen, einzelne Argumente zu entkräften, Lügen oder eigene Aussagen klarzustellen.
Einschränkend erklärt sie dennoch: „Menschen, die andere beleidigen oder diffamieren, sind nicht an einer inhaltlichen Auseinandersetzung interessiert.“ Am meisten helfen würde es, die Profile zu blocken, Kommentare zu melden und zur Anzeige zu bringen. Auch das könnten Betroffene offen kommunizieren, um zu zeigen, „dass sie sich wehren“.

Als positives Beispiel führt von Hodenberg den Blogger und Videojournalisten Tarik Tesfu an. Im vergangenen Jahr wurde der massiv im Netz angegangen, seine Social-Media-Konten wurden angegriffen, gehackt und gelöscht. Die Arbeiten von mehreren Jahren waren aus dem Netz verschwunden. Tesfu zog sich nach den Vorfällen eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurück. Er kam schließlich zurück und thematisierte das, was ihm passiert war. „Das ist sehr couragiert“, so von Hodenberg, „aber auch nicht leicht zu übertragen.“
Unverständnis über Gerichtsurteil
Einen anderen Weg ging Grünen-Chef Robert Habeck, der im Januar seine Auftritte bei Facebook und Twitter löschte. Der Politiker begründete sein Vorgehen folgendermaßen: Twitter sei ein „sehr hartes Medium, wo spaltend und polarisierend geredet wird“. Das färbe auch auf ihn ab. Habeck war davor mit einem Tweet über die Bayernwahl in die Kritik geraten. Gleichzeitig wurden private Daten von ihm im Netz öffentlich gemacht.
Habecks Parteikollegin Renate Künast ist im Moment die wohl bekannteste Klientin von HateAid. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete zog gemeinsam mit der Beratungsstelle vor Gericht, ist aber mit dem Versuch gescheitert, gegen Beschimpfungen vorzugehen. Laut einem Urteil des Landgerichts Berlin stellen entsprechende Kommentare „keine Diffamierung der Person der Antragstellerin und damit keine Beleidigungen“ dar.
Unbekannte hatten die frühere Ministerin Künast auf Facebook unter anderem als „Stück Scheiß“ und „Geisteskranke“ bezeichnet und noch drastischere Posts verfasst. Selbst die Bezeichnung „Drecksfotze“ bewege sich haarscharf an der Grenze des noch hinnehmbaren. Eine Beleidigung liege nicht vor, bemerkte das Berliner Landgericht in seinem Urteilsspruch. „Von einer Schmähung kann nicht ausgegangen werden, wenn die Äußerungen im Kontext einer Sachauseinandersetzung stehen“, heißt es.
Aus der Bundespolitik erfuhr Renate Künast parteiübergreifende Solidarität. Die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann schrieb nach dem Urteil auf Twitter: „Unfassbar. Jetzt müssen wir zusammenrücken. Die Sprache der Radikalen fasst Fuß. Und die Gerichte lassen es laufen“. Sogar der Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion Christian Lüth äußerte Unverständnis.
Viel Nachholbedarf bei der Polizei
„Der Mordfall Lübcke hat gezeigt, dass die massive Beleidigung im Netz auch zu analogen Taten führen kann, weil so ein toxisches Umfeld geschaffen wird, in dem sich Menschen ermutigt fühlen, die verbal geäußerten Ideen zu realisieren. Und sie haben das Gefühl, dass ihnen die Mehrheit im Netz zujubelt, was bei Walter Lübcke ja auch der Fall war“, sagt Anna-Lena von Hodenberg. Sie wünscht sich ein Signal aus den Justizministerien, damit nicht nur die Sensibilität wachse, sondern genauso die Aufarbeitung von digitaler Gewalt professioneller geführt werde.
„Die rasante Entwicklung im Netz hat dazu geführt, dass die Strafverfolgung über Jahre nicht mehr hintergekommen ist. Polizei und Justiz verstehen oft gar nicht, um welche Phänomene es sich handelt, und dass es eben nicht nur um eine einfache Beleidigung geht.“ Genau daran scheitere die Arbeit von HateAid noch zu oft.
Besonders rau sei der Ton in den Netzwerken am Sonntagabend – für viele ein mentaler Tiefpunkt, erzählt von Hodenberg, „weil das Wochenende zu Ende geht und Montagfrüh wieder die Arbeit ruft. Daher laden besonders viele Menschen ihre negative Emotionen im Netz ab, auch jene, die sonst wenig damit zu tun haben. Die pöbeln dann meistens dort, wo sich der Mob ohnehin schon austobt“.
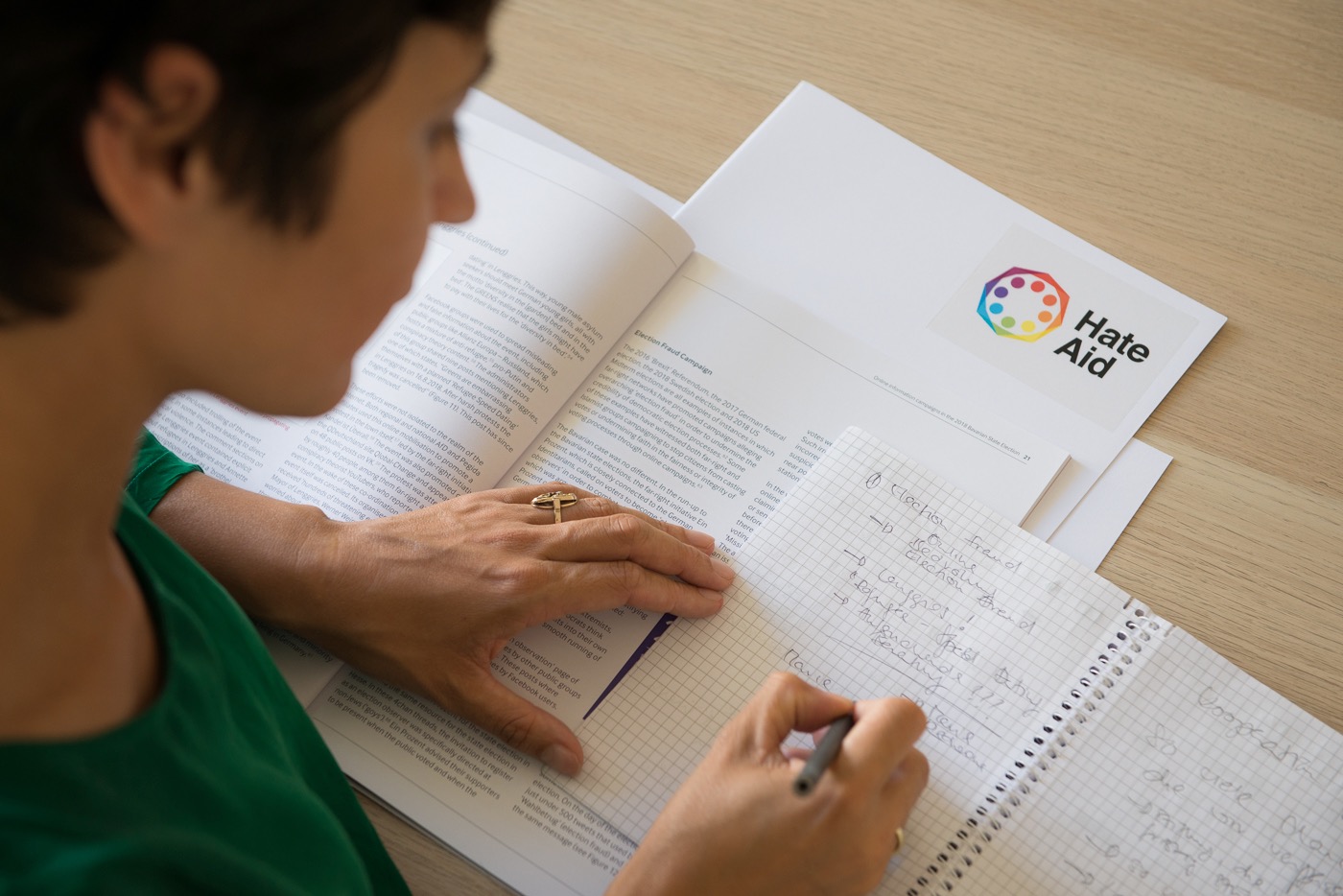
Von Hodenberg unterscheidet zwischen dem diffusen Hass, der sich einfach entlädt und keine echte politische Motivation verfolge und den organisierten rechtsextremen Online-Gruppen. Mit Konsequenzen hätten aber alle zu rechnen, auch Fake-Accounts. Der Sonntag sei aber genau die Zeit, die HateAid bisher noch nicht mit abdecken könne. Für die Zukunft wünscht sie sich eine Rund-um-die-Uhr-Beratung, wenigstens telefonische Sprechzeiten frühmorgens und spätabends.
Unternehmen halten sich bedeckt
„Wir haben online alles passieren lassen, ohne dabei an die negativen Folgen zu denken. Um das zu ändern, braucht es den politischen und gesellschaftlichen Willen, in Zukunft daran zu arbeiten.“ Nichtsdestotrotz werde das Netz nie ein Ort frei von Gewalt sein, aber es gehe um ein erträgliches Maß. Die von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geforderten Regeln fürs Internet brauche es dazu jedoch nicht, „die analogen Gesetze müssen einfach auch im Netz durchgesetzt werden.“
Andere Abgeordnete müsse von Hodenberg nicht mehr wirklich für das Thema sensibilisieren, die wüssten aus eigener Erfahrung, was digitale Gewalt bedeute. Und dennoch fehle es weiterhin an digitaler Kompetenz, sowohl in den Parteien als auch in den meisten Ministerien. Dabei verhandelt die Gesellschaft heute die meisten öffentlichen Debatten im Netz, bemerkt von Hodenberg.

„Wir müssen nun entscheiden, anhand welcher Kriterien der Meinungswettstreit ablaufen soll. Wir müssen uns im Netz in der Sache hart streiten können, aber ohne Hass und Hetze zu verbreiten“. Die HateAid-Chefin fordert daher auch mehr Courage im Netz, den sie genauso als öffentlichen Raum versteht, „den ich mitgestalten und gegen andere verteidigen will“. Google und Facebook kritisiert sie dafür, dass die in den vergangenen Jahre ihre Algorithmen dahingehend getrimmt hätten, dass diese vor allem auf Posts oder Kommentare anspringen würden, die negative Emotionen wecken.
„Letztlich geht es doch darum, dass wir möglichst lange auf deren Seiten verweilen – und das tun wir immer dann, wenn wir mit Wut und Hass konfrontiert sind. Wozu das gesellschaftlich führt, wurde nicht durchdacht. Heute brauchen wir passende Ideen, um das wieder in geregelte Bahnen zu bringen.”
Auf Veto erscheinen Geschichten über Menschen, die etwas bewegen wollen. Wer unsere Idee teilt und mithelfen möchte, kann das unter steadyhq.com/veto tun.








